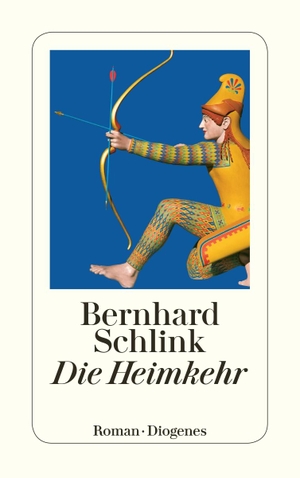Wo man auch hinschaut in diesem Roman, alles hat mit der Odyssee zu tun, berichtet der Rezensent Giery Cavelty. Vor allem ist da der Groschenroman, den der in Westdeutschland ohne Vater aufgewachsene Peter Debauer auf dem Dachboden entdeckt, und in dem der anonyme Autor die Heimkehr eines Wehrmachts-Odysseus aus russischer Gefangenschaft in Peters Heimatstadt beschreibt. Und da ist auch der verschwundene Vater, der sich als der Autor des Heimkehrerromans entpuppt: John de Baur, ehemals Nazi-Propagandist, der sich nach dem Krieg als KZ-Überlebender ausgab und nun als Rechtsprofessor in den USA lehrt und sich in seinen Seminaren mit der Odyssee beschäftigt. Dabei, so der Rezensent, vertritt er einen so "extrem dekonstruktivistischen" Standpunkt, dass einem schwindelig wird: Genauso wie der Leser - und nicht der Autor - für den Sinn eines Textes verantwortlich ist, genauso liegt das Böse einer Tat nicht bei dem Täter, sondern bei dem Ankläger. Eine These, mit der sich de Baur elegant und skrupellos entlastet. Vor allem dadurch, dass der Sohn sich einerseits vor der "bösartigen Demagogie dieser Gedankengänge" ekelt, dass ihm aber andererseits die Kaltschnäuzigkeit des Vaters imponiert, wird der Roman für den Rezensenten zu einem "nicht ganz harmlosen Gesinnungstest" von "beklemmendem Reiz". Unzumutbar findet Cavelty allerdings die mangelnde literarische Qualität, die sich in der allzu "konstruierten" Handlung, dem laxen Stil und den zu "Ideenträgern" degradierten Figuren offenbare.